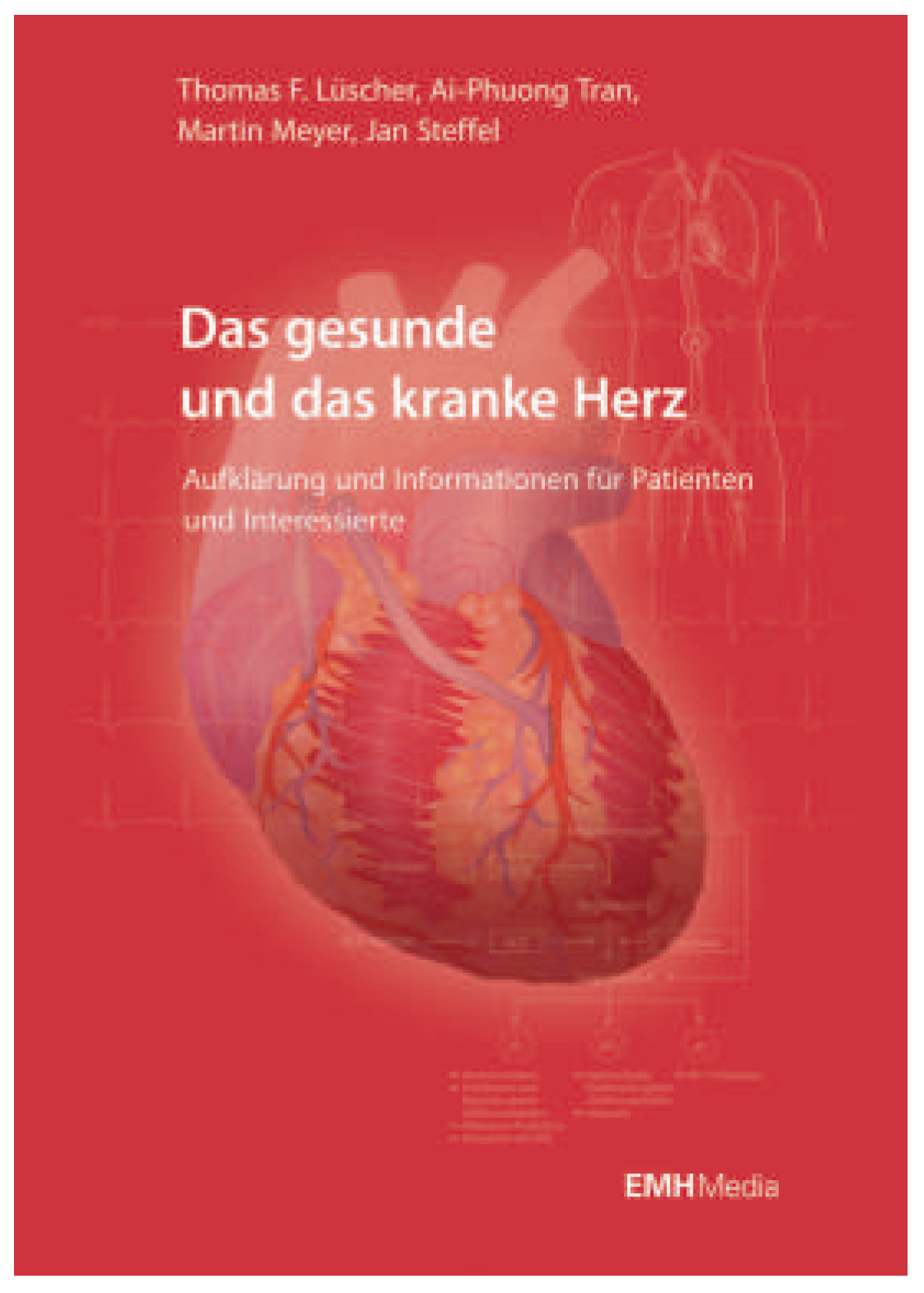Seither haben sich die Möglichkeiten der Medizin beeindruckend entwickelt. Es gelingt uns nicht nur, Schmerz zu lindern; die Heilkunst kann ihrem Namen gemäss auch heilen, z.B. Infektionskrankheiten, oder auch wirksam behandeln, z.B. den Herzinfarkt, Herzklappenleiden, einige Tumorleiden und vieles mehr. Mit der Wirksamkeit medizinischer Massnahmen kamen aber auch Nebenwirkungen mit ins Spiel: Was wirkt, kann auch schaden. Als Helfen nicht nur zunehmend half, sondern auch Unerwünschtes, ja gar Schaden mit sich bringen konnte, musste sich das Arzt-Patienten-Verhältnis langsam, aber unaufhaltsam ändern. Wo man nicht nur Erfolg versprechen kann, muss nicht nur der Nutzen, sondern auch das Risiko besprochen sein. Auch stellt sich damit die Frage, was die beste Massnahme für den individuellen Patienten sei. Zunächst entschieden die Ärzte selbstherrlich und uneingeschränkt – der Patient verstand ja sowieso nicht, wie die Sache sich verhielt. Noch zu Assistenzzeiten des Schreibenden wurde nicht allen Patienten die Diagnose vermittelt, insbesondere wenn es sich um Tumoren handelte – eine heute undenkbare Haltung. Nun ist «informed consent» gefragt: Als Folge der Untaten brauner Schergen entstand die Helsinki-Deklaration und danach die Forderung des Weltärztebundes, bei jeder ärztlichen Handlung die Gesundheit der Patienten ins Zentrum aller Überlegungen zu stellen (The health of my patient will be my first consideration), ja als Anwalt des Patienten uneingeschränkt seine Interessen zu vertreten (A physician should select in the patient’s best interest when providing medical care).
Damals war aus der historischen Erfahrung heraus vor allem der Schutz der Patienten vor verbrecherischen Handlungen entscheidend; heute sind ökonomische Aspekte weit wichtiger [
2]. Mit der Ökonomisierung der Medizin meldete sich ein bisher unbekannter Druck auf die Entscheidungsfindung des Arztes: Das Budget des CEO (und der Versicherungen [
3]) wurde plötzlich spürbar, die Unabhängigkeit ärztlichen Handels wahrnehmbar eingeschränkt. Dann machte die beherrschende Bedeutung des Geldes im modernen Denken auch vor Ärzten nicht halt: Die Versuchung, bei allgemeinen Patienten das Nötigste und bei Privatversicherten möglichst viel zu tun, ist heute dokumentiert in Klinik und Praxis präsent [
4].
Mit «informed consent» kam der Bedarf nach dem «educated patient»: Nur ein Patient, der Grundlegendes über seinen Körper weiss, kann den Ausführungen seines Arztes folgen. Nur eine Patientin, die Nutzen und Gefahren verschiedener Verfahren kennt, kann informiert entscheiden – und heute entscheiden letztlich die Patienten. Für vernünftige Entscheidungen ist Zugang zu Informationen in Laiensprache erforderlich. Dazu braucht es eine eingehende, für den Patienten verständliche Aufklärung des Sachverhalts, d.h. der Krankheit sowie der Möglichkeiten ihrer Behandlung und vor allem deren Nutzen und Risiken. Die ärztliche Kunst besteht hier darin, zwischen Einsicht und Angst den richtigen Weg für die Patientenaufklärung zu finden.
Und es wurde bereits einiges erreicht: Diabetiker behandeln sich seit langem selbständig unter Aufsicht ihres Arztes. Viele Hypertoniker messen sich regelmässig den Blutdruck selbst [
5] und kennen die Zielwerte und die Wirkung ihrer Medikamente. Selbständige Patienten halten sich eher an die Verordnungen [
6]. Sie sind nicht nur besser eingestellt, sie brauchen auch weniger Ressourcen.
Doch nicht überall konnte sich der «educated patient» wirksam entwickeln. Die häufigste Informationsquelle ist Dr. Google – gewiss findet sich dort viel Gutes, aber auch viel Marketing und Junk.
Vorträge werden z.B. von der Seniorenuniversität, Kliniken und dem «Zurich Heart House» angeboten und gut besucht, was den Bedarf der Patienten unterstreicht (
Figure 1). Eine unabhängige, breit zugängliche Informationsquelle ist ein Bedürfnis. Mit dem Buch «Das gesunde und das kranke Herz» [
7] (
Figure 2) haben Autoren des UniversitätsSpitals in Zürich ein Lehrbuch für Patienten geschaffen, das reich illustriert mit intuitiv erfassbaren Abbildungen und einem allgemein verständlichen Text den Zugang zum Laien sucht. Die Devise war:
«You must be able to explain it to your grandmother», wie ein amerikanischer Mentor den Schreibenden einst lehrte. Nur wer einfach zu erklären weiss, hat die Sache wirklich verstanden. Das vorliegende Buch des Teams des Universitären Herzzentrums Zürich hat versucht, diesen Weg zu beschreiten.
Wir sind überzeugt, dass damit medizinische Massnahmen sinnvoller und nachhaltiger eingesetzt werden und sich damit auch der Outcome vieler Patienten verbessern lässt.
Bei 3055 Infarktpatienten des schweizerischen SPUMRegisters zeigte sich, dass immerhin jeder 18. Patient das Statin und jeder 25. Patient das Aspirin nach einem Jahr auf Rat ihres Arztes – entgegen den Empfehlungen aller Richtlinien [
8] – abgesetzt hatten [
9]. Auch wenn nicht alle Kollegen dies gerne hören: Der «educated patient» würde nachfragen – zum Nutzen seiner selbst und des Gesundheitssystems, das weniger Rehospitalisationen und erneute Eingriffe zu verkraften hätte. Ebenso zeigte sich, dass viele Patienten mit familiärer Hypercholesterinämie und entsprechend hohem Infarktrisiko bereits in jüngerem Alter unbehandelt ein kardiales Ereignis erleiden [
10] – der aufgeklärte Patient hätte dies für sich und seine Familienangehörigen vermieden.
Wissen und Bildung können Leben retten. Nicht nur Ärztinnen und Ärzte, auch «educated patients» können dazu beitragen.