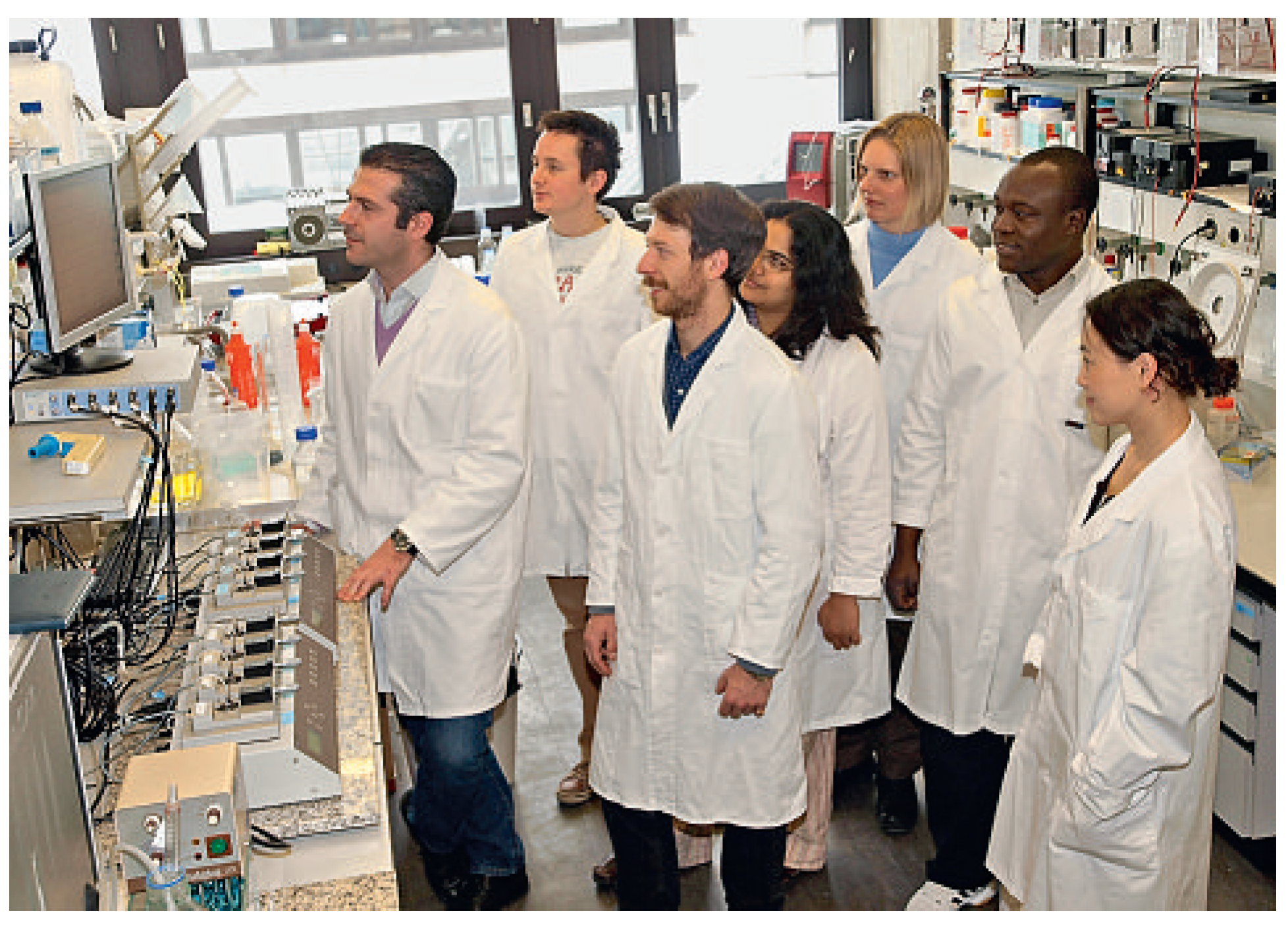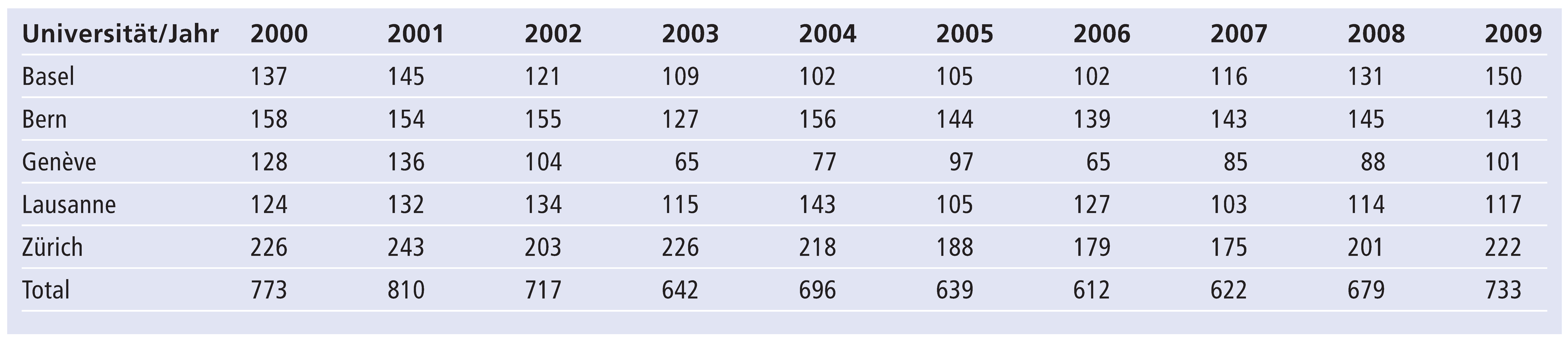Stürmische Zeiten
Das letzte Jahr des ersten Jahrzehnts des neuen Jahrhunderts hatte es in sich für die Schweiz: Steuerprobleme mit den USA, Geiseln in Libyen, ein ebenso blamabler wie vergeblicher Gang nach Canossa unseres Bundespräsidenten zu dessen Herrscher, einem deutschen Minister, der uns kleinmachte. Und dann plötzlich dieser Lichtblick im November: Wir sind wieder wer! Fussballweltmeister – wer hätte das gedacht. Gewiss, die U-17 und nicht die Mannschaft, die in Südafrika antreten wird, aber immerhin, das gab Hoffnung für die Zukunft. Auf Bildern des beeindruckenden Ereignisses in Lagos sieht man die ausgelassenen Spieler im nationalen rot-weissen T-Shirt, wie sie das 1:0 gegen Nigeria feiern. Nach dem ersten Stolpern bei der Lektüre reibt man sich die Augen: Hat unsere Schweiz wirklich gewonnen? Ja, gewiss, die Namen sind etwas ungewohnt, Sturzenegger, Bickel und Künzli lägen uns näher, doch die Zeiten sind heute anders. Giaccobo hat es auf den Punkt gebracht: Was heisst U-17 eigentlich? 17 «Ussländer», natürlich …
Was den Amerikanern, einem Volk von Einwanderern, eine Selbstverständlichkeit ist, die Aufnahme von Secondos, ja Primeros, in ihre Staatsgemeinschaft, bleibt den Schweizern selbst bei solch freudigen Ereignissen eine heimliche Last. Gewiss, die Spieler mit Vornamen wie Kofi und Granit, verfügen über einen Schweizer Pass – nur der arme Josip Drmic hatte trotz seines akzentfreien Dialektes zuhause bleiben müssen, da es ihm im Schweizertest nicht gelungen war, alle Nachbargemeinden von Freienbach aufzuzählen … – doch für rechte Bürger dieses Landes bleiben sie irgendwie doch Papierlischweizer [
1].
We speak English
Als wäre dies nicht genug, ein weiteres Erlebnis Ende der Woche im Forschungslabor der Klinik: Zu Beginn wurden wie jeden Freitag die
Grant Deadlines, zu Deutsch die Einreichungstermine für Projekte bei Stiftungen und Forschungsinstitutionen, durchgesehen. Beim Anwählen der Homepage einer bestimmten Stiftung ergab sich die Anforderung, dass die Antragssteller Schweizer Bürger zu sein hätten.
«Who is a Swiss Citizen?», fragt der Schreibende in die Runde der Post-Docs, Dissertanden und Assistenten – Ruhe, keine Antwort aus dem Saal. Zum ersten Mal seit Bestehen der Forschungsgruppe kein Schweizer? Natürlich weiss die Forschungsgruppe mit Stolz Mitarbeiter aus 14 Ländern, aus Deutschland, Italien, Indien, China, den USA, ja fast der ganzen Welt, unter sich (
Abb. 1), doch nun plötzlich kein Schweizer, der sich melden könnte? Eine Neuigkeit, die selbst im Zeitalter der globalen Welt beunruhigt. Nicht, dass es für den Erfolg der Gruppe entscheidend wäre, nein, in der Forschung zählt die Entdeckung des Neuen – wer immer es findet, ist weniger wichtig; dennoch spürt man schmerzlich das plötzliche Fehlen jeden heimatlichen Elements in der eigenen Gruppe.
Verstärkung aus dem Norden
Tags darauf auf Visite auf der Bettenstation: Man spricht schon reflexmässig hochdeutsch, wenn ein neuer Assistent im Abteilungsbüro sitzt, auch diesmal mit Recht. Nicht, dass er seine Sache nicht gut machen würde: Nein, im Gegenteil, er weiss Bescheid, ist hilfsbereit und nett im Umgang mit dem Patienten. Dennoch stellt man sich die Frage, wo die Schweizer geblieben sind. Am Staatsexamen sind es, wie man hört [
2], auch weniger Kandidaten als in früheren Jahren. Weshalb vermögen wir die verfügbaren Stellen nicht mit Abgängern unserer Universitäten zu besetzen? Gewiss, an Universitätskliniken hatten wir schon immer ausländische Assistenten, und dies mit Stolz, die Internationalität gehört seit jeher zum Markenzeichen der akademischen Medizin, gerade in unserem Land. Der Inseratenkampagne der SVP zum Trotz haben unschweizerische Namen wie Billroth, Sauerbruch, Yasargil, Senning, Turina, Grüntzig und andere mehr zum Ruhm unserer Medizin entscheidend beigetragen (
Tab. 1). Ein kleines Land wie die Schweiz verfügt nicht über genug Nachwuchs, um alle Lehrstühle seiner fünf Universitäten mit eigenen Bürgern zu besetzen. Ja, gerade diese Gnade der Kleinheit hat die Schweizer Universitäten schon vor Jahrzehnten, als für die meisten anderen Länder Globalität noch ein Fremdwort war, gezwungen, begabte Ärzte, Forscher und Akademiker aus anderen Ländern zu fördern oder zu berufen. Diese Internationalität gereichte unserem Land gewiss zum Guten: Schweizer Universitäten sind international gut aufgestellt, ihre Ärzte haben Medizingeschichte geschrieben und mischen noch heute, vor allem in den Neurowissenschaften, der Kardiologie, Onkologie, Immunologie und Diabetologie, an der Spitze mit –
what’s the problem? Entwertung der akademischen Medizin
Eigentlich sollten wir auf unsere Medizin stolz sein und die Sache auf sich beruhen lassen. Wer Spitzenmedizin in unserem Land betreibt, ist zunächst unbedeutend; wichtig ist, dass sie verfügbar ist und bleibt. Und dennoch beunruhigt dieser rasch um sich greifende Trend: Wo sind die Schweizer geblieben? Was sind die Gründe für den nachlassenden Beitrag unserer eigenen Bürger an die akademische Medizin unseres Landes? Gewiss, einfach ist der Weg nicht. Forschung ist ein unsicheres Geschäft, interessante Ergebnisse sind nicht vorgegeben, Erfolg wird nicht versprochen, man weiss nicht, ob man ein Projekt zu einer erfolgreichen Publikation führen, ob man die Medizin bewegen kann. Dann sind die Stellen meist spärlich und über Drittmittel finanziert, eine sichere Stellung muss man sich erst über Jahre verdienen. Auch die Konkurrenz ist heute weltweit, die Annahmequote von Manuskripten in angesehenen Journalen liegt durchwegs unter 20% – kurz, der Weg zu einer Chefarztstelle oder Professur erscheint unendlich lang und ungewiss. Mutlosigkeit greift um sich, bevor man sich auf den Weg macht. Gerade ein noch vom Wohlstand verwöhntes Land hat wohl Mühe, Risiken und Herausforderungen als Ansporn aufzufassen, und geht lieber den sicheren Weg. Die Entwertung von «role models» in einer der Gleichmacherei verpflichteten Kultur schliesslich tat das ihre; eine Gesellschaft, welche gerade die Erfolgreichen mit medialer Häme gerne bei jeder sich bietenden Gelegenheit abgebaut hat [
9].
Anders die aufstrebende Generation des erwachenden Ostens. Was man in Musik, Kunst und Sport wahrnimmt – der Weg des Chinesen Lang Lang aus der Provinz eines Entwicklungslandes an die Weltspitze der Klaviermusik ist paradigmatisch (
Abb. 2) [
3] – macht sich auch in der medizinischen Forschung bemerkbar: Der hochmotivierte und arbeitsame Nachwuchs aus China, Indien und den Oststaaten drängt nach vorne. Diese Mediziner und Forscher kennen keine 50-Stunden-Woche –
Can I work longer?, hat kürzlich eine chinesische Post-Doc gefragt –, nehmen Widerstände und Schwierigkeiten auf sich und sind entschlossen, langfristig etwas zu erreichen.
Doch es ist nicht nur die Konkurrenz, die das Leben beschwerlich macht: Viele Probleme sind hausgemacht, die Vernachlässigung der Naturwissenschaften in unseren Gymnasien, die kulturelle Entwertung der Technik in unserer Gesellschaft – die grüne Weltsicht, die Tierversuche, Biotechnologie und Gentechnik, jeden Eingriff in das Natürliche, als Werk des Teufels sieht – haben das Ansehen der Forschung, des Fortschritts insgesamt und damit der universitären Medizin gemindert, mit absehbar bedeutenden Folgen: Was nicht anerkannt und bewundert wird, gibt kaum zu Höchstleistungen Anlass. Wenn man in Gesellschaft glaubt, sich entschuldigen zu müssen, wenn man mit genmanipulierten Mäusen, Stammzellen oder der Intensivmedizin arbeitet, wendet man sich lieber der Vermögensverwaltung, dem Marketing oder der Juristerei zu.
Nicht zuletzt spielt auch das Geld eine Rolle: In einer Gesellschaft des siegreichen Kapitalismus, in welcher der Geldwert ein ungeahntes Ansehen erlangt hat, wird ein unsicherer Weg mit geringem Salär zum Martyrium, auch wenn am Ende möglicherweise ein gutes Einkommen winkt. Diesen Weg wollen sich die verwöhnten Jungbürger eines reichen Landes immer weniger zumuten. Die Privatmedizin und die Verlockung auf ein hohes Einkommen bereits im jungen Alter werden ebenso wie Unbeschwerteres wie Banking, Business und Marketing zur Verführung für die Begabten.
Selbstgemachter Ärztemangel
Die Knappheit an Medizinern betrifft jedoch nicht nur Universitätskliniken, auch für Kantons- und Bezirksspitäler wird es zunehmend schwierig, freiwerdende Stellen für Ärzte wie für Pflegende mit Schweizern zu besetzen. Bekannt ist das wachsende Nachwuchsproblem in Arztpraxen, besonders ausserhalb städtischer Räume. Wo sind die Studienabgänger unserer Universitäten? Ein gewisser Rückgang lässt sich nicht bestreiten (
Tab. 2). In der Schweiz ging die Zahl seit 2000 von 773 im Jahr 2009 um 5% zurück [
2]. Wenn wir den Mittelwert nehmen, sind es gar 14%. Dies ist zwar nicht dramatisch, aber doch bedeutend, zumal es zweifellos mehr Ärzte braucht als früher. Die Gründe für diesen Mehrbedarf sind vielfach: (1.) Die Einführung der 50-Stunden-Woche für Assistenten und Oberärzte; (2.) das Wachstum vieler Disziplinen aufgrund des technischen Fortschritts; (3.) die Feminisierung der Medizin und (4.) die steigende Verfügbarkeit alternativer Karrieren ausserhalb der Gesundheitsversorgung.
Dass es für einen 24-Stunden-Dienst mehr Ärzte braucht, wenn die Arbeitszeit beschränkt wird, liegt auf der Hand. In einigen Disziplinen, zumal chirurgischen Fächern, hat die Einführung der 50-Stunden-Woche zu einer erheblichen Aufstockung der Assistenz- und Oberarztstellen geführt. In anderen Fächern wie der Kardiologie sind aufgrund des medizinischen Fortschritts 24-Stunden-Dienste – in diesem Fall für akute Katheterinterventionen beim Herzinfarkt – erst in den letzten 10 Jahren zur Routine geworden, und neue Bereiche wie die Rhythmologie, das kardiale Imaging und die Herzinsuffizienz haben sich so stark entwickelt, dass zusätzliche Spezialärzte benötigt werden. Die Feminisierung der Medizin – in Zürich stieg der Anteil weiblicher Studenten an der Medizinischen Fakultät in hundert Jahren von einzelnen Pionierinnen auf zurzeit zwei Drittel – hat zu einer Zunahme von teilzeitbeschäftigten Ärztinnen und familiärbedingten Berufsabbrechern geführt; damit sinkt der Anteil junger Ärztinnen und Ärzte, welche vollzeitlich in der Gesundheitsversorgung tätig werden und es auch bleiben. Schliesslich hat der Ausbau der Krankenkassen, Gesundheitsämter wie der pharmazeutischen und Device Industrie vermehrt alternative Möglichkeiten der beruflichen Entwicklung für Ärzte geschaffen – somit: Es braucht entgegen den Erwartungen der Politik mehr Medizinstudenten, um den Bedarf zu decken.
Was es bräuchte …
Das alles ist einfacher gesagt, als dass sich Lösungen finden. Gewiss, die Beschränkung des Zugangs zum Medizinstudium müsste als Erstes gelockert werden. Wo Mangel herrscht, machen solche Massnahmen keinen Sinn. Doch damit ist noch nicht viel erreicht; was es bräuchte, ist eine Aufwertung des Berufs als solchen, wenn wir die Medizin langfristig nicht Zuwanderern allein überlassen wollen. Eine Gesellschaft, die den Arztberuf entwertet, wie es auch in unserem Land geschieht, darf sich über die Folgen nicht wundern. Angefangen hat diese Entwicklung beim Hausarzt, der bald schon nichts mehr darf, dem Labor und Hausbesuche vergällt werden, der inzwischen weniger verdient als viele Banker, Juristen oder Beamte. Gewiss, der Mensch lebt nicht vom Geld allein, doch scheinen heute sowohl Einkommen wie Ansehen den Grundversorgern zu entgleiten – so schaffen wir keinen Nachwuchs für einen anspruchsvollen und zeitaufwendigen Beruf. Zwar ist, wie Umfragen belegen, den Schweizern ihre Gesundheit das weitaus Wichtigste [
4], die Hausärzte aber, die ersten Ansprechpartner in dieser Sache, scheint man dabei zu vergessen [
5].
Die Spitalärzte sind die nächsten, die, erdrückt von Administration, Regulierungen ihres Tuns durch Staat und Krankenkassen und von der Beschränkung ihres Einkommens, die Freude am Beruf verlieren. Die Universitätsprofessoren und Chefärzte werden medial mit Lust abgebaut, bis dass der Beruf keine
«role models» mehr unter sich weiss. Für den Nachwuchs sind es nicht zuletzt bewunderte Vorbilder, die die Berufswahl bestimmen [
6]. Umsichtiges Urteilen, umfassendes Wissen, technisches Geschick und wissenschaftliche Kreativität müssten das Ansehen zurückgewinnen, das heute vornehmlich dem erwirtschafteten Lohn, dem Geldwert, zusteht – kurz: Eine Rückbesinnung auf den Wert der Arbeit, gerade der helfenden Tätigkeit wie der Medizin, täte not.
Was wir zunächst aus dem Gesagten lernen können, ist zweierlei: Die staatliche Planung des ärztlichen Nachwuchses erreichte nicht ihren Zweck. Prognosen sind schwierig, besonders, wenn sie die Zukunft betreffen
(Niels Bohr) – auch der Bedarf an Ärzten ist nicht vorhersehbar und kann sich schneller ändern, als die Politik es zu fassen vermag. Weiter darf eine Gesellschaft, die einen Berufsstand nachhaltig entwertet, sich nicht über den Niedergang eines wichtigen Bedarfs beklagen. Ja, die Zukunft der Schweiz, so scheint es nach der Krise [
7], liegt nicht mehr in den Händen der Banker und Investors, die das letzte Jahrzehnt geprägt haben. Vielmehr sollten wir uns auf Tätigkeiten besinnen, die etwas erschaffen: Für die grossen Entwicklungen der Zukunft wie Informatik, Nanotechnologie, Life Sciences und Medizin, um nur die wichtigsten zu nennen, braucht unser Land einen motivierten Nachwuchs in Naturwissenschaften, Medizin und Engineering.
Heimat als Ort des Wirkens
Das oben Gedachte bringt uns zurück zu einer grundsätzlicheren Frage: Muss die Entwicklung eines Landes, müssen seine Leistungen, seine Zukunft ausschliesslich von ihren Bürgern erbracht werden? Und wenn ja, wer sind diese Bürger, die diese Aufgaben zu erfüllen hätten? Dass dies unmöglich mit den seit Jahrhunderten bei uns Beheimateten allein zu bewerkstelligen ist, haben wir erläutert. Man kann die Frage also durchaus verneinen – entscheidend bleibt, dass es geschieht, wer es umsetzt, ist weniger wichtig.
Vielleicht fusst dieses Unbehagen auf einer falschen oder doch wenig nutzbringenden Vorstellung von Herkunft. Was ist Herkunft und was ist Heimat? In alten Zeiten waren Blut und Boden damit verbunden; Heimat war dort, wo die Vorfahren seit Generationen gelebt und gewirkt hatten. Heimat war vererbt und nicht erworben. Herkunft blieb unveränderbar und durch den Boden der Vorfahren gegeben. In der globalen Welt ist dies anders. Max Frisch hatte den neuen Heimatbegriff vorgedacht: Heimat ist, wo man sich zu Hause fühlt [
8]. Heimat ist nicht zwingend durch Geburt gegeben, sie ist nicht genetisch bestimmt. Heimat kann man sich aussuchen. Heimat kann man annehmen, auch wenn man zu Hause serbisch oder englisch spricht. Wenn sich Haris Seferovic nach dem Siegestreffer im Finale heftig auf die Brust mit dem roten TShirt klopfte, dann war das ein Zeichen der Zugehörigkeit [
1]. Heimat ist der Ort, mit dem man sich identifiziert. Das gilt auch für Mediziner: Wenn es sich in der weniger hierarchischen Schweiz besser arbeiten lässt, wenn man bei uns mehr lernt, unser Land im Abbau des ärztlichen Berufs noch nicht so weit gelangt ist wie anderswo, wir hervorragende Ärzte und Forscher unter uns wissen, die den besten Nachwuchs aus aller Welt anziehen, dann ist Heimat dort, wo sich jeder am besten zu verwirklichen vermag, zum Nutzen aller.