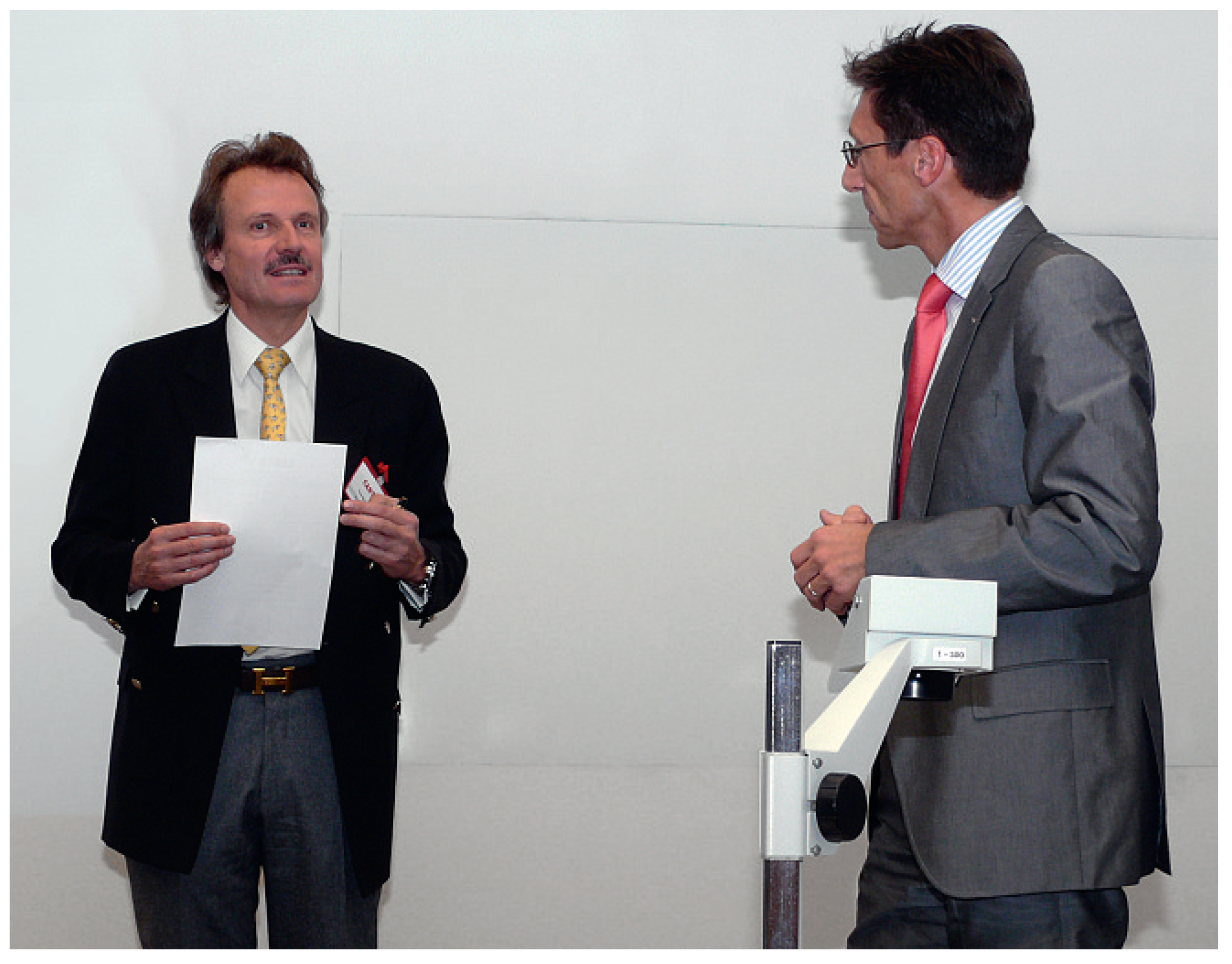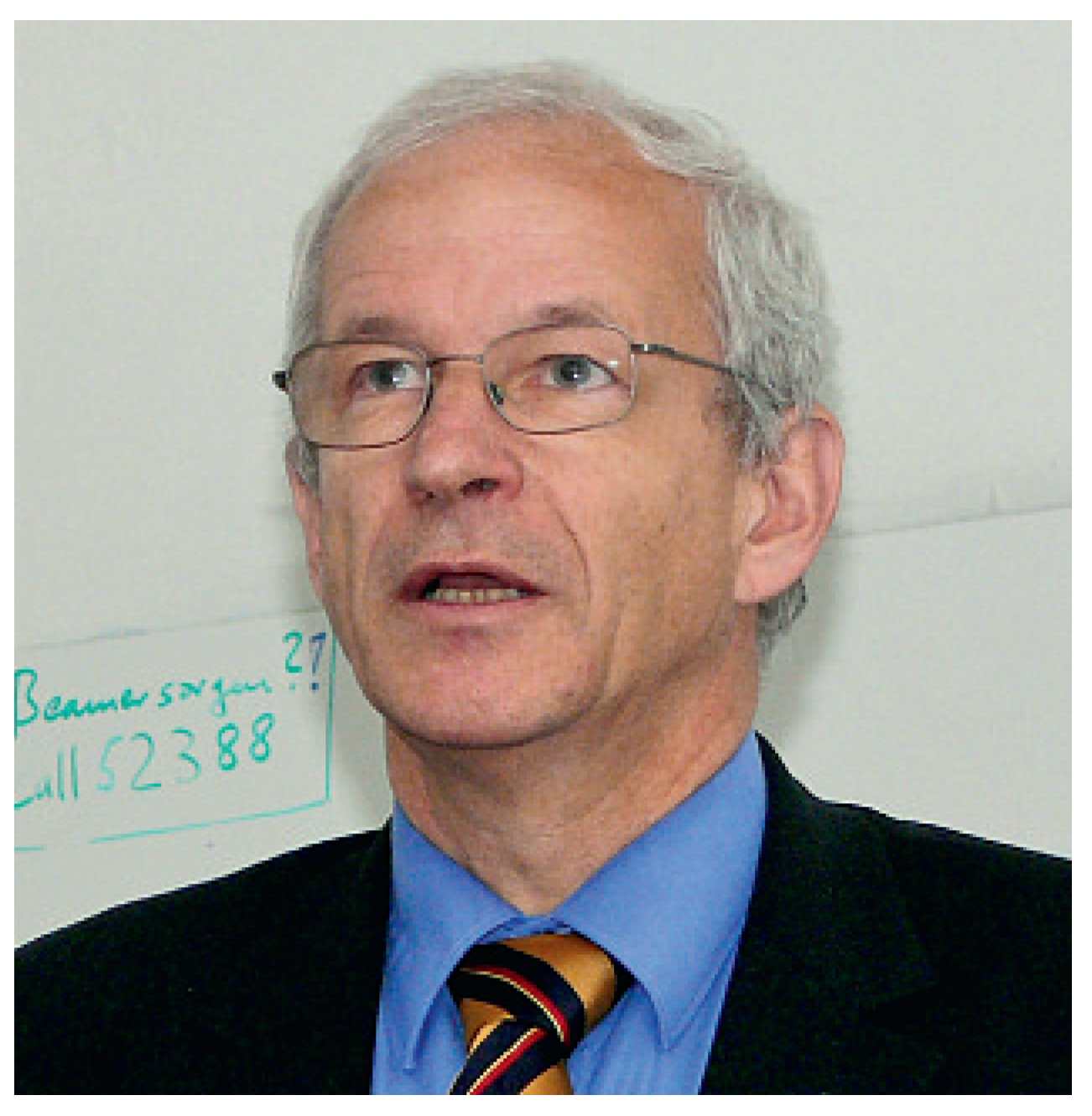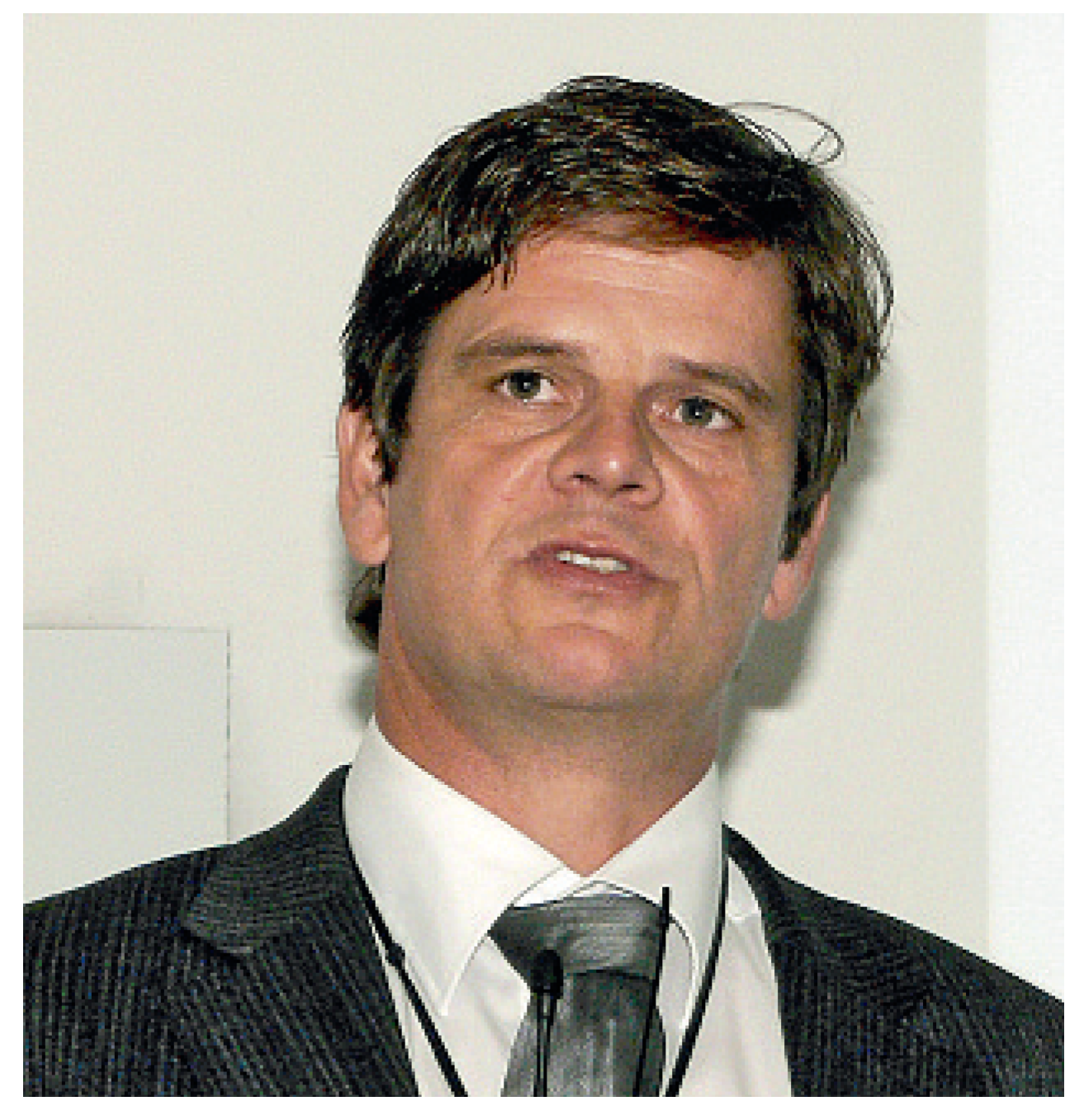Hintergrund
CARTA, der «Cardiovascular Roundtable» zwischen führenden Vertretern der kardiovaskulären Medizin, der Pharmaund Medizinaltechnikindustrie sowie der Gesundheits- und Bildungspolitik, wurde am 24. Oktober 2008 am Universitätsspital Zürich zum fünften Mal durchgeführt. Ziel dieser Veranstaltung ist es, den offenen Meinungsaustausch zwischen den Partnern im Gesundheitswesen zu fördern und die Entscheidungsträger zu einem besseren gegenseitigen Verständnis sowie einer konstruktiven Zusammenarbeit anzuregen.
Schwerpunktthemen in diesem Jahr bildeten die Globalisierung und ihre Auswirkungen an den Hochschulen und in der Medizin. Der Gesundheitsmarkt Schweiz kann sich dem überall spürbaren Trend der Globalisierung nicht verschliessen und muss sich dieser Herausforderung stellen. Ein hochkarätiges Gremium beschäftigte sich mit der Bedeutung dieser Veränderungen für die Qualität der medizinischen Versorgung, die universitäre Ausbildung und das Arztbild im neuen Jahrhundert. Auch die Erwartungshaltung der Patienten wandelt sich im Zeitalter des Internets. Die neuen Potenziale von E-Health und Telemedizin werden die medizinische Versorgungsstruktur verändern. Durch den Anlass führten mit fachkundiger Moderation der Gesundheitsökonom Willy Oggier (Abb. 1) und der Thoraxchirurg Walter Weder (Abb. 2).
Abbildung 1.
Dr. Willy Oggier, Moderator.
Abbildung 1.
Dr. Willy Oggier, Moderator.
Abbildung 2.
Prof. Walter Weder, Moderator.
Abbildung 2.
Prof. Walter Weder, Moderator.
Die Regierung stärkt den Denkplatz Zürich
In seinem Eröffnungsreferat erläuterte der Zürcher Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger (Abb. 3) die neuen Pläne des Regierungsrats und die Ziele der laufenden Legislaturperiode 2007– 2011. Am Denkplatz Zürich findet sich mit der ETH, der Universität und dem Universitätsspital eine einzigartige Kombination von renommierten Institutionen mit hochkarätigen Experten zusammen. In diesen hochspezialisierten Zentren sollen im Rahmen der interkantonalen Gesamtstrategie Spitzenleistungen gefördert werden. Zürich soll sich gemäss den Plänen des Regierungsrates auf die medizinischen Gebiete Herz-Kreislauf, Onkologie und Neurowissenschaften konzentrieren. In der Forschung sollen die Schwerpunkte bei der Transplantationsmedizin, Immunologie und Molekularmedizin gesetzt werden. Im klinischen Dienstleistungsbereich sollen die innovationsträchtigen Gebiete Intensivmedizin (Life Support), Traumatologie und Orthopädie gestärkt werden. Mit dieser wirkungsvollen Schwerpunktbildung und Investitionen von rund 30 Millionen Franken soll der Standort Zürich ausgebaut sowie die Flexibilität und Geschwindigkeit im international kompetitiven Forschungsumfeld gefördert werden.
Abbildung 3.
Regierungsrat Dr. Thomas Heiniger will den Denkplatz Zürich stärken.
Abbildung 3.
Regierungsrat Dr. Thomas Heiniger will den Denkplatz Zürich stärken.
Die Globalisierung bietet für Heiniger Wachstumsmöglichkeiten, neue Marktchancen und die Förderung von Mobilität bei Personen und Produkten. Durch die Globalisierung entsteht mehr Wettbewerb auf der Seite der Patienten, aber auch zwischen Ärzten und Forschern. Er mahnte aber, die Risiken der Globalisierung im Auge zu behalten. Die aktuelle Finanzkrise habe gezeigt, dass die Schweiz durch wechselseitige Abhängigkeiten in komplexen Systemen grösseren Risiken aus dem Ausland ausgesetzt werden könne. Es sei dabei die vorrangige Aufgabe der Politik, Spielregeln und gesellschaftliche Rahmenbedingungen bei diesen neuen Konstellationen festzulegen, Stabilität zu garantieren und mögliche Risiken im Auge zu behalten.
Auf seiner Tour d’Horizon schloss Heiniger mit einigen Betrachtungen zum Internet ab. Die weltweite Vernetzung ermöglicht den Zugang zu Wissen und Informationen sowie den Konsum in den eigenen vier Wänden. Dank den neuen Möglichkeiten können ältere Menschen länger zu Hause betreut und medizinisch überwacht werden. Soziologisch kann die maximale Vernetzung mit einer zunehmenden Vereinsamung und Isolierung verbunden sein.
Komplexe Strukturen des Schweizer Gesundheitsmarktes
Vom Denkplatz Zürich leitete Ständerat Hans Altherr (Abb. 4) über in ländliche Gefilde. Er betrachtete die Schweiz aus der Vogelschau vom Säntis aus und charakterisierte das schweizerische Gesundheitswesen als besonders komplex und kompliziert, bedingt durch den Föderalismus, eine Vielzahl von Krankenkassen, eine unterschiedliche Finanzierung von ambulanten und stationären Behandlungen sowie die Konkurrenz zwischen öffentlichen und privaten Spitälern.
Abbildung 4.
Ständerat Dr. Hans Altherr will die kantonalen Strategien harmonisieren.
Abbildung 4.
Ständerat Dr. Hans Altherr will die kantonalen Strategien harmonisieren.
Ausserdem ging er auf die aktuellen Themen der Gesundheitspolitik im eidgenössischen Parlament ein. Die kantonalen Strategien sollen harmonisiert werden. Als erstes wird die neue einheitliche Spitalfinanzierung ab 1. Januar 2009 in der ganzen Schweiz in Kraft treten mit einer anteilmässigen Kostenübernahme von 55% durch die Kantone und 45% durch die Krankenkassen. Schon bald wird in der Schweiz ein neues Wettbewerbssystem mit freier Spitalwahl im ganzen Land gelten. Beim Bundesrat liegt eine Motion für eine einheitliche Finanzierung des ambulanten und stationären Sektors mit einem Zeithorizont von drei Jahren vor. Das Thema Vertragsfreiheit erhitzt die Gemüter. Altherr wies auf das Modell von Willy Oggier hin, das für Patient, Arzt und Kassen mehr Flexibilität in der Steuerung bietet und damit die medizinische Versorgung vergünstigen und verbessern könnte. Unter dem Stichwort «nutzenorientierter Wettbewerb» versteht Hans Altherr, mehr Transparenz bei den Leistungen von Spitälern und Ärzteteams zu schaffen, um den Wettbewerb und die Qualität der Versorgung zu fördern.
Aus internationaler Sicht brachten die bilateralen Verträge eine Grenzöffnung für die Arbeitnehmer. Bereits jetzt kommen 45% der Assistenzärzte an Schweizer Spitälern aus dem Ausland. Die Grenzen wurden aber auch für Leistungsbezüger geöffnet, was ein neues Marktpotenzial für ausländische Selbstzahler bringt. Unsicher ist zurzeit noch die Finanzierung der Weiterbildung an den Spitälern. Da die Kosten von Lehre und Forschung als gemeinwirtschaftliche Leistungen nicht mehr ins Budget einfliessen dürfen, könnten die Spitäler in Zukunft weniger Interesse an der Ausbildung von Assistenzärzten haben.
Wettbewerb und Qualität in der Medizin
Im Gesundheitswesen ist die Suche nach Marktmechanismen ein zentrales Thema. Medizin ist aber nicht nur ein Business, sondern Medizin ist auch Hingabe und Berufung, meinte der Kardiologe Thomas F. Lüscher (Abb. 5). Als Beispiel nannte er den Herzchirurgen Ake Senning, der für die Entwicklung des ersten Herzschrittmachers kein gewinnträchtiges Patent anmeldete. Heute haben die rasanten medizinischen Entwicklungen und die Technisierung zu einem Wachstum des Marktes und einer Verteuerung geführt. Gleichzeitig haben die steigenden Kosten und Finanzierungsprobleme die Betriebswirtschafter auf den Plan gerufen, und Geld wird zunehmend zur Treibkraft medizinischen Handelns. Die Suche nach Rentabilität hat in operativen Fächern, die Gewinn versprechen, zu einer Inflation von Kompetenz-Zentren geführt.
Abbildung 5.
Prof. Thomas F. Lüscher (links) und Dr. Thomas Heiniger in der Diskussion.
Abbildung 5.
Prof. Thomas F. Lüscher (links) und Dr. Thomas Heiniger in der Diskussion.
In der Kardiologie weist die Schweiz 26 invasiv-tätige Zentren für 7,5 Mio. Bürger aus, was ein Rekord ist. Für 15 Mio. Einwohner leisten sich die Niederlande 10 Zentren, in Dänemark gibt es 4 Zentren für 4,5 Mio. Einwohner. Der Kanton Zürich weist mit 7 invasiv-kardiologisch tätigen Zentren neben der Stadt New York die grösste Dichte auf. Das birgt die Gefahr, dass sich in Zentren mit geringen Fallzahlen die Qualität verschlechtert und die Sterblichkeit erhöht. Lüscher verglich die Entwicklung mit einer Dosis-Antwort-Kurve von Qualität und Wettbewerb, bei der die Qualität bei zu viel Wettbewerb mit zu vielen Zentren plötzlich wieder nach unten tendiert. Zum guten Arzt gehören nicht nur Zuwendung und Können, sondern auch der Verzicht auf Unnötiges und Nutzloses. Er plädierte dabei für mehr Regulierung, insbesondere in der kostenintensiven Spitzenmedizin. In der anschliessenden Diskussion kristallisierte sich heraus, dass hier die Politik kaum handeln wird, weil deren Protagonisten sonst abgewählt würden.
Vision für ein Kompetenzzentrum ETH / Universitätsspital
Der Präsident der ETH Zürich, Ralph Eichler (Abb. 6), zeigte die wichtige Bedeutung der Medizintechnik am Beispiel der Firmen Straumann und Phonak für die schweizerische Wirtschaft auf. Die Stärke des Standortes Zürich ist die Verbindung zwischen den Ingenieurwissenschaften an der ETH und der Spitzenmedizin am Universitätsspital, wo die technischen Innovationen in interdisziplinären Teams erprobt und verbessert werden können. Die medizinischen Ingenieurwissenschaften sind an der ETH Zürich mit 39 Professuren in 7 Departementen gut etabliert. Beispielhaft ist auch die Gründung von zahlreichen Spin-off-Firmen in diesem Bereich. Die ETH Zürich will sich als bedeutender Hub für Medical Engineering etablieren.
Abbildung 6.
Prof. Ralph Eichler setzt sich für ein Kompetenz-Zentrum «Cardiovascular Engineering» ein.
Abbildung 6.
Prof. Ralph Eichler setzt sich für ein Kompetenz-Zentrum «Cardiovascular Engineering» ein.
In Partnerschaften mit der Industrie werden Mediziningenieure bestens ausgebildet. Eichler veranschaulichte diese Zusammenarbeit an verschiedenen erfolgreichen Projekten, wie der Entwicklung von bioresorbierbaren Stents, dem funktionellen MRI, der Modellierung «in Silico» von Malignomen sowie der Mikrotomographie der Lunge. Er erwähnte die Initiative für ein Kompetenz-Zentrum «Cardiovascular Engineering» mit einem eigenen Gebäude für ETH und Universitätsspital mit Medizinern und Ingenieuren nahe am Patienten. Der Kapitalbedarf dafür beträgt 115 Mio. Franken. Die Geldbeschaffung steckt noch in den Anfängen und soll über die ETH Foundation initialisiert werden. Ziel ist der Ausbau des Standortes Zürich als Zentrum für medizinische Biowissenschaften.
Entmystifizierung des «Gottes in Weiss»
Wichtige Marketinginstrumente wie Public Relations und Branding sind bisher im Gesundheitswesen vernachlässigt worden, meinte Martin Zenhäusern (Abb. 7). Spitäler und Ärzte sollten eine eigene Standortbestimmung vornehmen und sich fragen, wo ihre Stärken liegen, welche Dienstleistungen angeboten werden können und wie sie von den Patienten wahrgenommen werden. Es ist bekannt, dass eine positive Meinungsäusserung eines zufriedenen Patienten drei weitere Personen günstig beeinflusst, während eine negative Äusserung 11 weitere Personen ungünstig stimmt. Die Einstellung der Patienten gegenüber den Ärzten hat sich geändert. Der «Gott in Weiss» wird entmystifiziert und die Kosten werden höher gewichtet als der Nutzen. Der Aufbau einer Vertrauensbildung über die Kommunikation ist dabei wichtig. Diese Vertrauensbildung kann einer Marke gleichgesetzt werden, wobei die Kernkompetenzen bekannt gemacht und ethische Transparenz erstellt werden sollen. Die Beteiligten müssen sich im Klaren sein, was sie kommunizieren wollen und die Medien dafür einsetzen. Das erlaubt den Aufbau von Beziehungen und die Schaffung von Goodwill. Zenhäusern meinte, in der Medizin bestehe ein grosses Potenzial für Verbesserungen in den Bereichen Medienkenntnisse, Kommunikation und Positionierung.
Abbildung 7.
Martin Zenhäusern will im Gesundheitswesen mehr Marketinginstrumente einsetzen.
Abbildung 7.
Martin Zenhäusern will im Gesundheitswesen mehr Marketinginstrumente einsetzen.
Virtualisierung der Medizin
E-Health, virtuelle Patientenberatung und Telemedizin heissen die neuen Schlagwörter, die im Trend der Zeit liegen. Gemäss Christiane Brockes (Abb. 8) nimmt die medizinische Online-Beratung am Universitätsspital Zürich stark zu. Es treffen pro Jahr rund 6300 Anfragen ein bzw. rund 17 Fragen pro Tag. Antworten werden von einem Team von 6 Mitarbeitern, das die Fragen teilweise an 80 Spezialisten im USZ weiterreicht, innerhalb von 48 Stunden geliefert. Die Online-Beratung wird mehr von jüngeren Frauen als von Männern wahrgenommen. Sie gewährleistet Anonymität und kann unabhängig von Zeit und Ort durchgeführt werden. Den Patienten fällt es leichter, tabuisierte Themen und psychische Probleme anzusprechen. Oft haben diese Beratungen auch den Charakter einer Zweitmeinungsbildung.
Abbildung 8.
Dr. Christiane Brockes spricht über die Zunahme der medizinischen Online-Beratung.
Abbildung 8.
Dr. Christiane Brockes spricht über die Zunahme der medizinischen Online-Beratung.
Über die Zukunft von E-Health äusserte sich Serge Reichlin (Abb. 9). Unter dem Begriff versteht man ganz allgemein elektronische Austauschbeziehungen zwischen den Parteien im Gesundheitswesen. Dazu gehört der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien für die Organisation, die Unterstützung, die Vernetzung und die Infrastruktur von Prozessen und Akteuren. Im internationalen Vergleich ist die Schweiz gemäss Reichlin im Hintertreffen mit Informationssystemen in Spital und Praxis. Es gibt dafür Fehlanreize, wie die individuelle Optimierung, den Wunsch zum Bewahren von aktuellen Strukturen und eine geringe Motivation, Wissen zu teilen. In den Arztpraxen werden die Informationssysteme mit Ausnahme des Abrechnungssystems Tarmed viel zu wenig genutzt. Erst 12% aller Arztpraxen verwenden eine elektronische Patientenakte. Die elektronische Krankengeschichte würde eine vertikale Vernetzung zwischen Zuweisern und Spital sowie die horizontale Integration der Patientendaten im Spital ermöglichen. Viele Doppelspurigkeiten könnten vermieden und Kosten eingespart werden. Allerdings stellen sich dabei Fragen zur Datensicherheit, zum rechtlichen Umfeld sowie zu ethischen Aspekten. Reichlin ist jedoch davon überzeugt, dass die inhaltlichen Nutzen gegenüber den rechtlichen Risiken überwiegen.
Abbildung 9.
Dr. Serge Reichlin möchte mehr Informationssysteme in Arztpraxen.
Abbildung 9.
Dr. Serge Reichlin möchte mehr Informationssysteme in Arztpraxen.
Die Telemedizin dient der Überbrückung einer örtlichen und/oder zeitlichen Distanz zwischen Arzt und Patient. Gemäss Bertjo Frick (Abb. 10) wächst der Telemedizinmarkt in der Schweiz, insbesondere auch im Bereich der Kardiologie. Die Patienten sind von der Telemedizin begeistert, während sich die Mehrheit der Ärzte in Zurückhaltung übt. Frick zählte einige erfolgreiche Anwendungsbeispiele auf: telefonische Beratungen durch die Firma Medgate, die RhytmCard zur Aufzeichnung und Übermittlung von EKG oder das System EvoCare für Netzhautanalysen. Schon weit entwickelt ist das Telemonitoring von Schrittmacher- und ICD-Patienten, womit sich die engmaschige Nachkontrolle und lückenlose Überwachung der Patienten optimieren lässt. Tritt beim Patient ein Problem auf, ruft er ins Überwachungszentrum an, wo sein Gerät überprüft wird und er die nötigen Instruktionen erhält. Effizienz und Qualität der Behandlung können gesteigert und Arztbesuche reduziert werden. Leider ist jedoch die Frage der Abrechnungsmöglichkeiten durch die Leistungserbringer bei den Krankenversicherungen noch nicht gelöst.
Abbildung 10.
Bertjo Frick spricht über Anwendungen in der Telemedizin.
Abbildung 10.
Bertjo Frick spricht über Anwendungen in der Telemedizin.
Der mündige Patient
Ziel eines jeden Menschen ist es, möglichst lange aktiv und gesund zu bleiben, meinte Martin Fenner in seiner Darstellung über den neuen mündigen Patienten. Der Gesundheitsmarkt lässt sich in drei Bereiche einteilen: die Gesundheitsförderung, die Prävention und die Therapie. Das grösste Wachstumspotenzial hat gemäss Fenner das Segment der Prävention, wo Risikogruppen mehr Eigenverantwortung für ihre Gesundheit übernehmen können. Trotz Internet ist das Wissen über den eigenen Körper noch nicht sehr ausgeprägt. Während die meisten Leute die Kennzahlen des eigenen Autos, wie PS, Beschleunigung und Drehmoment bestens kennen, fällt das Wissen über Gesundheitsparameter wie BMI, Cholesterinwert, Blutzuckerspiegel, Knochendichte oder Lungenvolumen spärlicher aus.
Ökonomisch bedeutsame Krankheitsgebiete wie kardiovaskuläre Erkrankungen, COPD, Osteoporose haben identifizierbare und beeinflussbare Risikofaktoren. Im Laufe seiner Patientenkarriere benötigt der Bürger daher eine Begleitung, die bis heute unzureichend realisiert ist. Die Möglichkeiten der Leistungserbringer innerhalb der integrierten Gesundheitsversorgung sind vielfältig und es gilt, sie in Zukunft zu nutzen. Patienten benötigen auch zwischen den Arztvisiten Begleitung durch kompetentes Fachpersonal, z.B. durch Apotheker, Pflegefachpersonen oder neu zu definierende Gesundheitsberufe.
Breakout-Sessionen
In den drei Breakout-Sessionen wurden die Themen Globalisierung und Wettbewerb, Virtualisierung der Medizin sowie das Arztbild im 21. Jahrhundert in Gruppendiskussionen vertieft.
Das Thema Globalisierung und Wettbewerb wurde aus den beiden Perspektiven der Pharmaindustrie (Lorenz Borer) und der universitären Medizin und Forschung (Gregor Zünd) beleuchtet. Während bei den Pharmafirmen schon lange ein internationaler Wettbewerb herrscht, werden auch die Spitäler nicht mehr nur lokal, sondern vermehrt auch auf nationaler und globaler Ebene verglichen. Im Spitalsektor hat die Schweiz Strukturprobleme wegen des Föderalismus, der den Wettbewerb verhindert. In der Grundversorgung liegt die Schweiz international auf den obersten Rängen. Wichtiger ist jedoch langfristig in der Spitzenmedizin mitzuhalten und konkurrenzfähig zu bleiben. Entscheidend dabei ist, dass die Ergebnisse aus der Forschung schnell umgesetzt und zum Patienten gebracht werden, denn wenn man in der Champions League mitspielen will, muss man in die Offensive.
Günter Burg und Willy Oggier leiteten die Gruppe Virtualisierung der Medizin und definierten die Begriffe «Telelearning» und «Teleteaching» als Ergänzung zu Vorlesungen und Unterricht am Krankenbett. Recht verbreitet ist bereits das «Telecounselling» von Arzt zu Arzt zwischen Expertenzentrum und Peripherie. Die Gruppe stellte vier Thesen zur Telemedizin auf. (1.) Telemedizin soll dort eingesetzt werden, wo eine individuelle Therapie optimiert werden kann. (2.) Das Abrufen von internationalem Expertenwissen erschliesst neue Potenziale. (3.) Die Telemedizin leistet einen Beitrag zur Reduktion einer möglichen künftigen Ärzte-Unterversorgung. (4.) Im Idealfall leistet die Telemedizin einen Beitrag, die Triagefähigkeit zu verbessern.
Die dritte Gruppe unter der Leitung von Barbara Buddeberg-Fischer und Max Giger befasste sich mit der Veränderung des Arztbildes im 21. Jahrhundert. Die Neuausrichtung fängt schon in der Ausbildung an, wie die Geschlechterverteilung bei den Studienanfängern zeigt. Das Interesse der Männer am Arztberuf nimmt ab, während immer mehr Frauen die Medizin als attraktives Berufsfeld entdecken. Die Medizin wird zunehmend feminisiert, insbesondere in Disziplinen wie Pädiatrie und Gynäkologie/Geburtshilfe, während die operative Medizin nach wie vor eine Männerdomäne bleibt. Auch die Wahrnehmung der Work-Life-Balance hat sich bei den jungen Ärzten zugunsten von mehr Freizeit und Selbstverwirklichung geändert. Als Anbieter von Dienstleistungen sehen sich die Ärzte in ihrem Handlungsspielraum zunehmend eingeschränkt und dem Diktat der Krankenversicherer ausgeliefert. Der Arzt muss sich jedoch auf seine Grundaufgabe zurückbesinnen, nämlich das Vertrauen des Patienten zu gewinnen. Das Schlussvotum war dennoch sehr optimistisch für den ärztlichen Beruf. Die aktuelle Krise und Erschütterung der Finanzwelt könnte zu einem Wertewandel führen und auch den ideellen Werten in der Gesellschaft wieder mehr Aufwind verleihen. Damit könnte die Motivation für junge Männer, ein Studium der Medizin oder der Ingenieurwissenschaften zu ergreifen, wieder zunehmen (Abb. 11, 12).
Abbildung 11.
Publikum am CARTA 08.
Abbildung 11.
Publikum am CARTA 08.
Abbildung 12.
Publikum am CARTA 08.
Abbildung 12.
Publikum am CARTA 08.
Die Referenten/Referentinnen und Moderatoren der CARTA 08
- -
Dr. iur. Hans Altherr, Ständerat FDP, Trogen, Appenzell A.Rh.
- -
Lorenz Borer, Head Market Access, Novartis Pharma Schweiz AG, Bern
- -
Dr. med. Christiane Brockes-Bracht, Leiterin E-Health, Universitätsspital, Zürich
- -
Prof. Dr. med. Barbara Buddeberg-Fischer, Leitende Ärztin Psychosoziale Medizin, Universitätsspital, Zürich
- -
Prof. Dr. med. Günter Burg, Direktor Emeritus Klinik für Dermatologie, Universitätsspital, Zürich
- -
Prof. Dr. Ralph Eichler, Präsident ETH, Zürich
- -
Bertjo Frick, Project Manager Cardiac Rhythm Management, Medtronic (Schweiz) AG, Münchenbuchsee
- -
Dr. med. Martin Fenner, Medical Director Merck, Sharp & Dohme-Chibret AG, Glattbrugg
- -
Dr. med. Max Giger, Winterthur, Mitglied Zentralvorstand FMH
- -
Dr. iur. Thomas Heiniger, FDP Regierungsrat Zürich, Vorsteher Gesundheitsdirektion, Zürich
- -
Prof. Dr. med. Thomas F. Lüscher, Klinikdirektor Kardiologie, Universitätsspital, Zürich
- -
Dr. oec. HSG Willy Oggier, Gesundheitsökonomische Beratungen AG, Küsnacht
- -
Dr. med. Serge Reichlin, Head Business Development, Siemens Schweiz AG, Zürich
- -
Prof. Dr. med. Walter Weder, Klinikdirektor Thoraxchirurgie, Universitätsspital, Zürich
- -
Martin Zenhäusern, Inhaber Zenhäusern & Partner AG, Zürich
- -
Prof. Dr. med. Gregor Zünd, Direktor Forschung und Lehre, Universitätsspital, Zürich
Der «Cardiovascular Roundtable» (CARTA) wird organisiert von der Stiftung für Herz- und Kreislaufforschung, der Klinik für Kardiologie, Universitätsspital Zürich und CardioVasc Suisse, Bern.